>>>> Nicht verpassen: Frühbucherrabatt für die Masterclass Entbudgetierung nur noch bis 31. Januar! <<<<


Telefonische AU nicht verantwortlich für steigende AU-Zahlen
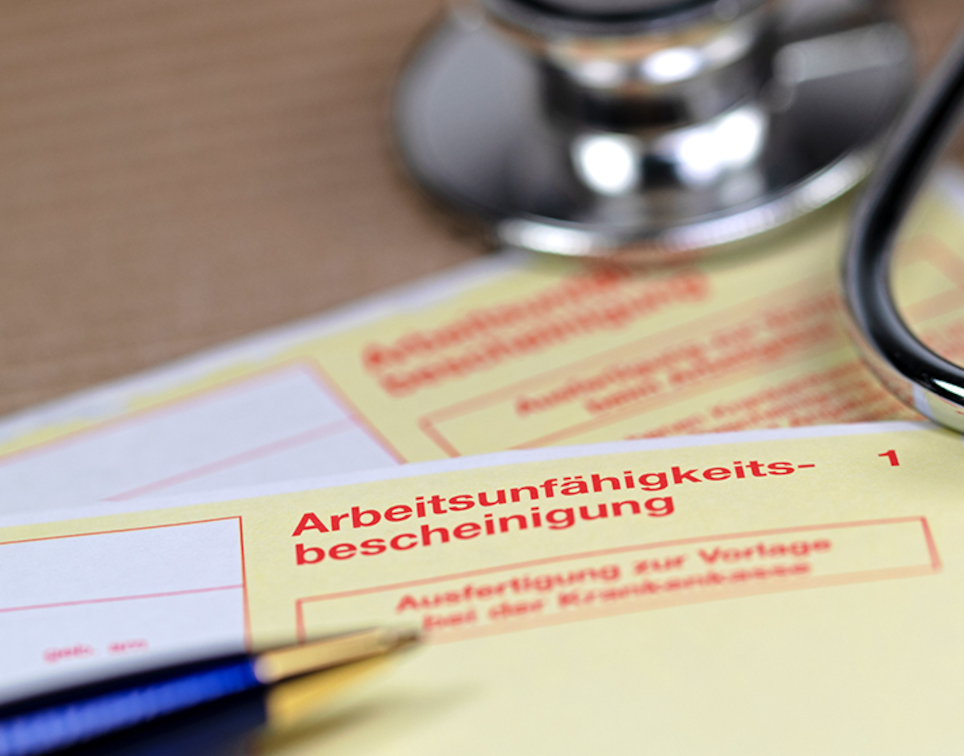
Das Zentralinstitut kassenärztliche Versorgung (Zi) hat eine umfassende Auswertung zu den Ursachen des Anstiegs von Arbeitsunfähigkeitsfällen veröffentlicht. Hintergrund ist die deutliche Zunahme der Krankschreibungen in den letzten Jahren. Diese lagen bei den größten gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2021 noch bei 95 bis 149 Fällen pro 100 Versichertenjahren, im Jahr 2023 schon zwischen 181 und 225 Fällen. Ein Anstieg um bis zu 95 %. Als Grund wird neben verschiedenen sozialen und arbeitsrechtlichen Aspekten auch die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung vermutet. Doch das Ergebnis der Zi-Analyse zeigt: Telefonische und video-basierte Krankschreibungen sind nicht ursächlich für den deutlichen Anstieg.
Spürbare Entlastung für Praxen
Wie Dr. Dominik von Stillfried, Vorstandsvorsitzender des Zi, erläutert, spielen sie in der Gesamtheit der Krankmeldungen nur eine untergeordnete Rolle. Der Anteil liege seit Jahren konstant bei rund 1 % aller Fälle. „Unsere Analysen zeigen klar, dass der Anstieg der AU-Zahlen vielmehr auf die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) und auf hohe Infektionsbelastungen in den vergangenen Jahren zurückzuführen ist“, so von Stillfried.
Auch Prof. Dr. Andreas Meusch, Leiter des Zi-Forschungsbereichs Versorgung, weist darauf hin, dass die eAU die Erfassungsrate erheblich verbessert habe. Dadurch erscheinen heute Krankmeldungen in den Statistiken, die früher oft gar nicht oder verspätet übermittelt wurden. Mit der digitalen Übermittlung seien die AU-Daten vollständiger, transparenter und systematisch erfasst, was die Zahlen naturgemäß ansteigen lasse.
Verdachtsfälle persönlich einbestellen
Einen weiteren Aspekt bringt Dr. Eckart Lummert, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes Niedersachsen, in die Diskussion ein. Er macht in der Meldung des Zi zur Analyse deutlich: „Die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung bei Patientinnen und Patienten ohne schwere Symptomatik ist eine wichtige Maßnahme zur Entbürokratisierung und Entlastung der Praxen.“ Zugleich trage sie zu einem besseren Infektionsschutz bei, wenn sich insbesondere atemwegserkrankte Patientinnen und Patienten nicht persönlich vorstellen müssen. Deshalb müsse, so Lummert, an der telefonischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung unbedingt festgehalten werden.
Allerdings mahnt er auch zur Differenzierung. Hausärztliche Praxen müssten verantwortungsvoll prüfen, wann eine persönliche Vorstellung erforderlich sei, etwa bei längeren Krankschreibungszeiträumen oder unklaren Verläufen. „In Verdachtsfällen bestelle ich die Betroffenen immer in die Praxis ein“, so Lummert. Das stärke das Vertrauen und verhindere Missverständnisse.
Unterstützung erhält diese Sichtweise auch von Anne-Kathrin Klemm, Alleinvorständin des BKK Dachverbandes. Sie betont, dass ein Missbrauch der Telefon-AU nicht belegbar sei, da es keine systematische Kennzeichnung der telemedizinisch ausgestellten AU gebe. Deshalb liefen Forderungen nach einer Abschaffung der Regelung ins Leere.
Niedrigschwellige Möglichkeit fördert Missbrauch?
Kritischer äußert sich dagegen Dr. Susanne Wagenmann, Leiterin der Abteilung Soziale Sicherung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Sie betont, Arbeitgebende müssten sich auf den hohen Beweiswert und die medizinische Richtigkeit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen unbedingt verlassen können. Daher müsse der Goldstandard der Krankschreibung weiterhin der persönliche Arzt-Patientenkontakt bleiben, gegebenenfalls ergänzt durch Videosprechstunden. Wagenmann warnt, die Telefon-AU und andere unpersönliche Krankschreibungsformen über Online-Portale erhöhten das Risiko von Missbrauch. Nach aktuellen Umfragen ließen sich bis zu 8 % der Beschäftigten ohne triftigen Grund krankschreiben. Um diese Zahlen zu senken, müsse man Fehlanreize konsequent beseitigen.
MT
© 2026 PKV Institut GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Sämtliche Texte und Bilder in unserem Online-Magazin sind urheberrechtlich geschützt. Bitte beachten Sie, dass auch dieser Artikel urheberrechtlich geschützt ist und nur mit schriftlicher Genehmigung des PKV Instituts wiederveröffentlicht und vervielfältigt werden darf. Wenden Sie sich hierzu bitte jederzeit unter Angabe des gewünschten Titels an unsere Redaktionsleitung Silke Uhlemann: redaktion(at)pkv-institut.de. Vielen Dank!
Die Nutzung der Inhalte des Online-Magazins für Text und Data Mining im Sinne des § 44b UrhG ist ausdrücklich vorbehalten (§ 44b Abs. 3 UrhG) und daher verboten. Die Inhalte dieses Werkes dürfen nicht zur Entwicklung, zum Training und/oder zur Anreicherung von KI-Systemen, insbesondere von generativen KI-Systemen, verwendet werden.
Gewinnen Sie den MFA-Award oder ZFA-Award!
Erzählen Sie uns, welche Rolle digitale Helfer in Ihrer Praxis spielen und bewerben Sie sich bis zum 27. Februar 2026.


